↑ home
zur Übersicht ↑ Britannien
Britannien: Die Fans des LFC
«Unity is Strength»
19. Dezember 2019 | Es gibt auch noch gute Geschichten aus Britannien. Beispielsweise die von Fussball-Fans, die sich nicht alles bieten lassen. Hier ein Kapitel aus dem Buch von Dietrich Schulze-Marmeling: «Reds».
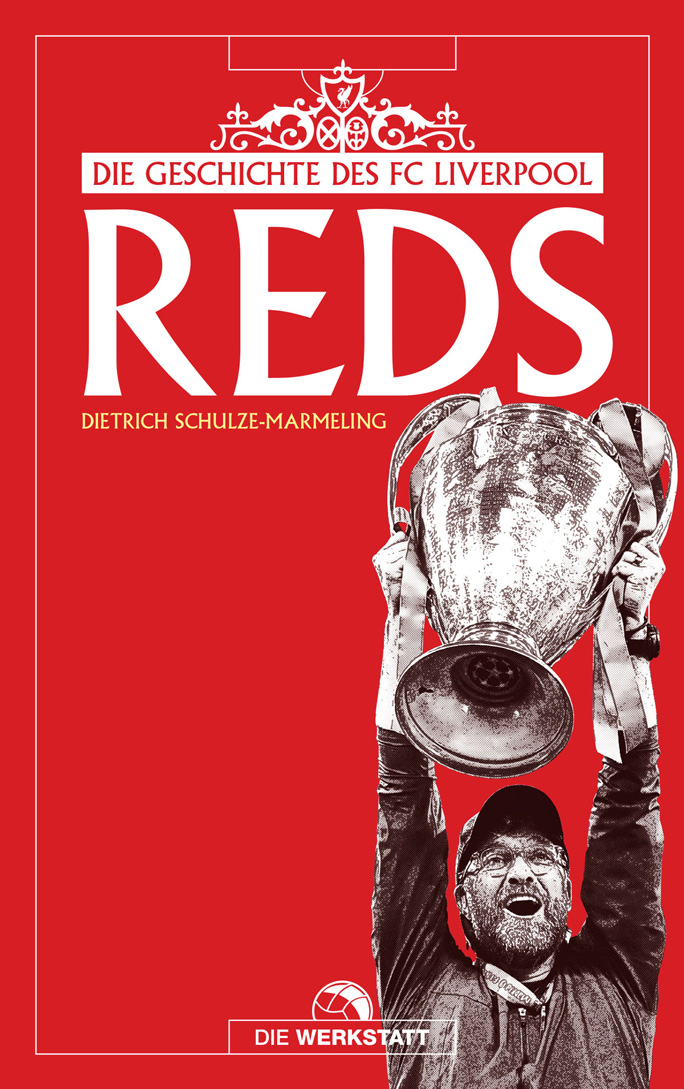 Es war nur eine kleine Begebenheit, die sich bei der Rückkehr von Liverpool-Fans aus Paris abspielte, und doch machte sie schnell die Runde. Ende November 2018, die Reds hatten das Champions-League-Spiel gegen Saint Germain 2:1 verloren, der Bus war schon wieder auf der Insel und fuhr auf der M25, als Passagiere ein Klopfen aus dem Gepäckraum hörten und den Busfahrer alarmierten. Der stoppte, öffnete die Klappe – und heraus kamen zwei junge Flüchtlinge.
Es war nur eine kleine Begebenheit, die sich bei der Rückkehr von Liverpool-Fans aus Paris abspielte, und doch machte sie schnell die Runde. Ende November 2018, die Reds hatten das Champions-League-Spiel gegen Saint Germain 2:1 verloren, der Bus war schon wieder auf der Insel und fuhr auf der M25, als Passagiere ein Klopfen aus dem Gepäckraum hörten und den Busfahrer alarmierten. Der stoppte, öffnete die Klappe – und heraus kamen zwei junge Flüchtlinge.
Das allein wäre noch keine Schlagzeilen im «Daily Mirror» oder im «Liverpool Echo» wert gewesen, wohl aber der Empfang, den die meist jugendlichen LFC-Fans den Asylsuchenden bereiteten. Sie hätten sie warm eingepackt, ihnen ein Fussballhemd geschenkt, Kekse angeboten, ihnen zu trinken gegeben, berichteten die Zeitungen. Und sie seien mit den beiden Syrern zusammen geblieben, bis ihnen gesagt wurde, dass die Flüchtlingen in Britannien einen Asylantrag stellen dürfen. Vorher allerdings hatten sie sich alle noch fotografieren lassen, Arme über die Schultern gelegt. Das Bild katapultierte sich fast von selbst durch die sozialen Medien.
Da war sie also wieder, die Empathie für die Schwachen und Geschundenen. Oder, wie Jeff Goulding, Autor des Buchs «Red Odyssey – Liverpool FC 1892-2017», schrieb: «Der Gemeinschaftssinn der Liverpooler und ihr Widerstand gegen Ungerechtigkeiten». Erfuhr nicht der unglückselige Loris Karuis durch den mächtigen Applaus der Fans eine späte Genugtuung, als er im August 2018 bei einem Testspiel gegen Turin eingewechselt wurde? Torwart Karius waren im Mai 2018, angeschlagen durch eine Gehirnerschütterung, im Champions-League-Finale zwei spielentscheidende Patzer unterlaufen – und niemand tröstete ihn nach Spielende, weder der Trainer noch die Mitspieler. Und hatten nicht LFC-Fans im September 2018 beim Auswärtsspiel gegen Chelsea ein riesiges Banner mit den Worten «Justice for Grenfell» entrollt? Im Jahr zuvor waren beim katastrophalen Brand des Sozialwohnungsblocks Grenfell im wohlhabenden Londoner Borough Kensington and Chelsea 72 Menschen umgekommen, weil die konservative Verwaltung alle Sicherheitswarnungen ignoriert und eine spätere Untersuchung kategorisch abgelehnt hatte.
Unbefangen auf Augenhöhe
«Unity is strength» steht auf einem Banner, das seit langem im Stadion an der Anfield Road zu sehen ist, Einigkeit macht stark. Die Einigkeit der Schwachen war schon immer nötig gewesen in dieser einst wohlhabenden, inzwischen aber bettelarmen Hafenstadt an der Mersey. Ohne Solidarität hätten die Seeleute, die Docker, die Fuhrleute und die Eisenbahner – allesamt Tagelöhner – nicht den Transportarbeiterstreik 1911 gewonnen, mit denen sie die Anerkennung ihrer Gewerkschaften durchsetzen. Ohne Zusammenhalt wären die Armen während der Massenarbeitslosigkeit in den 1930er Jahren untergegangen. Ohne ihren Gemeinschaftsgeist hätten sie in den 60er und 70er Jahren nie die Vielzahl an Arbeitsniederlegungen in den Docks und den damaligen Großbetrieben von British Leyland oder Ford durchgehalten. Kollektives Vorgehen war schließlich das einzige Mittel auf den Schiffen, in den Docks und im Transportwesen gewesen in dieser Stadt, die sich einst als Tor zum Britischen Empire feierte und deren Reeder, Kaufleute und Sklavenhändler Liverpool zum (nach London) früher zweitwichtigsten Handels- und Finanzzentrum des Landes machten. Liverpool – das bedeutete seinerzeit unglaublichen Reichtum auf der einen und prekäres Leben in den feuchten und lichtlosen Slums auf der anderen Seite, wo auch zahllose MigrantInnen (vor allem aus Irland) vegetierten und die durchschnittliche Lebenserwartung bei 26 Jahren lag.
Es gab nicht nur den Zusammenhalt. Keine andere britische Stadt sei so sehr mit der Seefahrt und dem Hafen verbunden gewesen, schreibt der Soziologe Tony Lane in seinem Buch «Liverpool – Gateway of Empire». Zigtausende hätten zumindest einige Jahre auf den Schiffen angeheuert, und das habe die Menschen geprägt: Sie seien weltoffener gewesen, warmherziger, bunter, kosmopolitischer als etwa die Industriearbeiter von Manchester. «Sie begegnen einander selbstsicher und unbefangen auf Augenhöhe, sie durchlöchern fröhlich und respektlos jede Art von Anmassung, und Geld spielt für sie keine große Rolle.»
All das ist lange her. Und doch hat sich an den Gegensätzen nicht viel geändert. Das Empire ist verschwunden, der Hafen – früher der bedeutendste Britanniens – ist längst nicht mehr das Scharnier des britischen Außenhandels, mit dem zwischenzeitlichen EWG-/EU-Beitritt verlagerten sich die Warenströme auf die andere Seite der Insel. Zwar kam es in der Nachkriegszeit zu einem kurzfristigen Boom, der den allmählichen Niedergang der Hafenindustrie (Schiffsbau, Tabak- und Zuckerverarbeitung) wettmachte. Doch die Großbetriebe, die multinationale Konzerne in den fünfziger und sechziger Jahren in die Region gestellt hatten, verschwanden wieder im Zuge der Deindustrialisierungspolitik der konservativen Regierung unter Margaret Thatcher – trotz der enormen Gegenwehr, die die Belegschaften von British Leyland, Dunlop und anderer Konzerne mit ihren Massendemonstrationen, Betriebsbesetzungen und anhaltenden Streiks an den Tag legten. In dieser Phase des wirtschaftlichen Zerfalls (der auch zu einem erheblichen Bevölkerungsschwund führte) gab es für die Scouser – wie sich die Liverpudlians nennen – nurmehr zwei Dinge, die ihnen ein Selbstwertgefühl vermitteln konnten: Die vibrierende Popkultur. Und der Fussball.
Heilige Dreifaltigkeit
Und so pilgerten sie in Scharen hinauf zum Goodison Park, dem Stadion der FC Everton. Oder an die Anfield Road. Dort hatte Bill Shankly aus einer mittelmässigen Mannschaft ein erstklassiges Team geformt. Bis dahin war der LFC wie viele andere nordenglischen Clubs gewesen: allesamt Arbeitervereine, die samstagnachmittags gegeneinander antraten, wenn die Arbeiter aus den Fabriken strömten. Ein durchschnittlicher Club also, mal oben, mal unten und in den fünfziger Jahren ganz lange unten. Mit Shankly änderte sich das: Er beendete das bis dahin so beliebte Kick-and-Rush, führte neue Mannschaftsformationen und Trainingsmethoden ein, machte mit der Selbstverliebtheit einzelner Spieler Schluss, setzte stattdessen auf Teamwork, auf die schnelle Trennung vom Ball, auf den Allround-Spieler. Vor allem aber hauchte er dem Team einen Kampfgeist ein, der so gut zur Leidenschaft der Scouser passte – und hatte Erfolg damit.
Dazu respektierte Shankly, der in einem schottischen Kohlerevier aufgewachsen war, die Fans, die ihn dafür heute noch verehren. «Bei einem Fussballclub gibt es eine heilige Dreifaltigkeit», sagt er einmal: «Spieler, Trainer und die Fans.» Auf die Direktoren käme es hingegen nicht an; «die unterzeichnen nur die Schecks». Ein anderes Mal führte er aus: «Die Fans sind die größten im Land. Sie kennen das Spiel und wissen, was sie sehen wollen. Die Leute auf dem Kop geben dir ein Gefühl von Größe – und Demut.» Und so spielte sich der LFC unter ihm in die Herzen der Liverpooler Arbeiter, die sich bei Heimspielen zehntausendfach in der Südwestkurve des Anfield-Stadions versammelten, dem Spion Kop – benannt nach einem Hügel im südafrikanischen Burenkrieg, auf dem eine Einheit der britischen Kolonialarmee (darunter viele Liverpooler Soldaten) so dicht gedrängt stand, dass sie vom Gegner leicht zusammengeschossen werden konnte.
Eng zusammengepfercht standen die LFC-Fans auch in den sechziger und siebziger Jahren auf dem Kop an der Anfield Road, damals die Heimkurve mit dem weltweit wohl größten Fassungsvermögen (rund 30.000 Stehplätze an diesem Stadionende). Nur kam das Feuer jetzt von ihnen – mit ihrem beißenden Spott, ihrem erbarmungslosen Witz, ihren Gesängen. Die Stufen der heimischen Stehtribüne zogen sich, von stabilen Wellenbrechern unterteilt, vom Stadiondach bis hinters Tor. Schulter an Schulter standen sie da, die hinten drückten nach vorne, wenn der Ball in Strafnähe kam, die vorne drückten dagegen, und so wogte die Menge treppab, treppauf. Und wenn einer mal musste, bekam er den lapidaren Bescheid: «Piss doch in der Hosentasche des Vordermanns!» – «Aber das spürt der doch!» – Antwort: «Du hast doch auch nichts gemerkt, oder?» Diesen Witz habe ich Mitte der siebziger Jahre, als ich zum ersten Mal auf dem Kop stand, öfters gehört.
Der Kop war Arbeitertheater. Das Publikum verfolgte nicht nur die Handlung auf dem Spielfeld, es beobachtete sich selber bei der Beobachtung des Spiels und spielte mit. In den Pubs der Stadt entwarfen informelle Fangruppen neue Schlachtrufe oder texteten Beatles-Songs um, die dann neben ihrem längst legendären «You Never Walk Alone» geschmettert wurden, einem Musicallied, das die Liverpooler Merseybeat-Band «Gerry and the Pacemakers» zu einem Spitzenplatz in den Charts verhalf und das Gerry Marsden 1963 noch vor der Veröffentlichung der Single Shankly vorspielte. Der Text («Wenn du durch einen Sturm gehst, geh erhobenen Haupts, und hab keine Angst vor der Dunkelheit … geh weiter, mit Hoffnung in deinem Herzen, und du wirst niemals alleine gehen») passte wie maßgeschneidert zu den Menschen dieser Stadt, in der die Arbeitslosigkeit selbst in guten Zeiten mindestens doppelt so hoch war wie im Landesdurchschnitt.
Überhaupt die Arbeitslosen: Als die BBC die fünfteilige TV-Serie «The Boys from the Blackstuff» über fünf jobsuchende Liverpooler Straßenbauarbeiter zeigte, stand für die Scouser von Anfang an fest, auf wessen Seite sie standen. Vor allem die Figur des eigenwilligen Yosser Hughes hatte es ihnen angetan, der immer dann, wenn er jemanden arbeiten sah, ausrief: «I could do that!» – «das könnte ich auch!». Und so johlten die Fans bei besonders gelungenen Spielzügen von Kenny Dalglish, Graeme Sounness, Ian Rush oder Phil Thompson mit großem Vergnügen: «I could do that!». Und noch immer macht die Geschichte von einer handgekritzelten Notiz die Runde: Der Pfarrer einer Stadtteilkirche hängte ein Schild mit der Aufschrift «Was würdest du tun, wenn Jesus nach Liverpool käme?» Darunter prangte schnell die Antwort: «Play St John at inside-left!». Ian St John, Shanklys Stammstürmer in den sechziger Jahren, «auf halblinks einsetzen». Die kreativste Menge, das ideenreichste Publikum des Landes, stehe auf den Rängen an der Anfield Road, hieß es in jenen Jahren.
Feindbild Fans
Dann kamen die achtziger Jahre. Viele Clubvorstände hatten sich inzwischen meilenweit von den Fans entfernt, die Monetarisierung der Freizeitindustrie machte sich bemerkbar, ebenso Thatchers Neoliberalismus und ihr Ich-ich-ich-Credo. Nur in Liverpool nahm vieles eine andere Richtung. Während anderswo die Konservativen die Wahlen gewannen, versanken die Tories an der Mersey in der Bedeutungslosigkeit. Während Thatcher die Gewerkschaftsrechte beschnitt und die Organisationen der Bergleute und Drucker besiegte, bauten die Liverpooler Trade Unions lebhafte Arbeitslosenzentren auf. Während die Regierung Gemeindewohnungen privatisierte und Sozialleistungen kürzte, schuf der an der Mersey dominante Labourflügel der trotzkistischen «Militant Tendency» nach der Revolte der afrobritischen Bevölkerung in Toxteth (1981) ab 1984 neuen Wohnraum, neue Arbeitsplätze, neue Sport- und Spielanlagen. Und während andernorts Hooligans durch die Straßen marodierten, blieben die Fans der Reds zwar rauh, aber einigermaßen gesittet. Jugendgangs mit ihrer Hackordnung, ihrer Brutalität, ihren Demonstrationen der Stärke und ihrer Fremdenfeindlichkeit gab es sporadisch auch hier, waren aber jeweils schnell wieder diszipliniert und von der Menge ruhig gestellt. Und doch traf die Liverpooler Fans Mitte der achtziger Jahre die Verachtung der gesamten internationalen Fußballwelt.
Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Trotz Protesten der Clubvorstände von Liverpool und Juventus Turin hatte die UEFA das baufällige Brüsseler Heyselstadion als Austragungsort des Europacup-Finales 1985 ausgesucht – und das in einem Land, dessen Polizei damals über wenig Erfahrung in der Handhabung so vieler Schlachtenbummler verfügte. Überhaupt stand seinerzeit weniger die Sicherheit der Menschen und auch nicht der Zustand der Spielstätten im Vordergrund als die Kontrolle der Menge. Doch nicht einmal diese hatten am Abend des 29. Mai 1985 die Behörden und des Verbands im Blick; dabei war es im Jahr zuvor beim Finale Liverpool gegen AS Rom (in Rom) zu hässlichen Szenen gekommen, als Liverpool-Fans attackiert und rund drei Dutzend durch Messerstiche verletzt wurden. Ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass Engländer aus dem rechtsextremen Spektrum zum Finale nach Brüssel reisen würden, wurden ebenfalls ignoriert. Und dann hatten die offenbar völlig überforderten Verantwortlichen die Ticketvergabe teilweise dem Markt überlassen – mit der Folge, dass in einer Kurve zwar zwei Sektoren (X und Y) für die Liverpooler Fans reserviert waren, die dritte jedoch (Z) über den Schwarzhandel gefüllt wurde, den vor allem italienische Arbeitsmigranten in der belgischen Hautstadt in Anspruch nahmen.
Getrennt waren die Sektoren dieses Stadionbereichs mit seinen zerbröckelnden Terrassen und maroden Mauern lediglich von wackligen Maschendrahtzäunen. Und so kam, was nicht hätte kommen müssen: Wer genau wen provoziert hatte, ob zuerst englische Fans die italienischen mit herumliegenden Gesteinsbrocken beworfen hatten (oder umgekehrt), ließ sich später nicht mehr feststellen. Jedenfalls attackierten noch vor Spielbeginn kleine Gruppen des vollgestopften Sektors X den vorgeblich neutralen Sektor Z, wo vor allem Tifosi standen. Sie lösten damit eine Massenpanik aus, in deren Verlauf Menschen niedergetrampelt und erdrückt wurden, bis eine Wand einstürzte. 39 Fans (darunter zwei Jugendliche) starben, davon 32 aus Italien, vier aus Belgien, zwei aus Frankreich und ein Liverpool-Fan aus Nordirland. Dann wurde angepfiffen.
Der Aufschrei war enorm. Zwar kam ein hochrangiger Offizier der Londoner Feuerwehr, den die britische Regierung später zur Untersuchung nach Brüssel schickte, zum Schluss, dass die vielen Toten zu einem «großen, großen Teil dem erbärmlichen Zustand des Stadions» zuzuschreiben seien, doch für die UEFA stand sofort fest: «Allein die englischen Fans» hätten die Katastrophe verursacht. Ausgerechnet die Liverpooler, die – anders als die Hooligans anderer Vereine – bis dahin kaum durch Gewaltexzesse auf dem Kontinent aufgefallen waren, galten plötzlich als Abschaum Europas. Nach Heysel sperrte die UEFA alle englischen Vereine für fünf Jahre, darunter auch Everton, das sich wie Liverpool in den Jahren 1986 bis 1989 zwei Mal als Landesmeister für den Europcup qualifiziert hätte. Der LFC blieb sechs Jahre lang von europäischen Turnieren ausgeschlossen – und spielte lange Jahre national wie international keine große Rolle mehr. «Wenn eine Handvoll Juventus- und Liverpool-Fans in einem Pub das Finale von 1985 organisiert hätten – das Resultat hätte nicht schlimmer ausfallen können», sagt Rogan Taylor, der über Jahrzehnte hinweg kein Spiel der Reds ausgelassen hatte und nur deswegen nicht in Heysel war, weil er kein Ticket bekommen hatte.
Reclaim the Game
Wenige Wochen nach den Brüsseler Ereignissen gründeten er und vier Kumpel in Liverpool die Football Supporters Association (FSA), eine Mischung aus «Gewerkschaft und Verbraucherschutzorganisation», wie Taylor es formuliert. «Die Fans sind ja die aktivsten Konsumenten der Welt, darunter haben sie zu leiden. Sie beweisen eine Markentreue, auf die jedes andere Unternehmen neidisch wäre, sie waten durch jede Scheiße und zahlen viel Geld, um am Samstagnachmittag in der Pisse zu stehen.» Keine andere Industrie hat eine solche geduldige Kundschaft, die den Firmen auch noch ihren Nachwuchs frei Haus lieferten – das habe aufhören müssen. Die fünf Freunde schrieben Leserbriefe, entwarfen ein Programm (Mitsprache der Fans auf allen Ebenen, bessere Schulung der Sicherheitskräfte, Beibehaltung der Stehränge in den Stadien) und gaben die Zeitung «Reclaim The Game» heraus. «Es ging uns um die Demokratisierung des Spiels», sagt Taylor, der später Direktor der Football Industry Group an der Universität Liverpool wurde.
Nach einem ähnlich desolat organisierten Pokalfinale zwischen Liverpool und Everton 1986 stellten sie ein Dossier zusammen, das alle Beschwerden auflistete, und schickten es an die Football Association (die die Pokalspiele organisiert), an Polizeibehörden, an die Verwaltung des Wembley Stadions. Die Reaktion war gleich Null: «Die Verantwortlichen hielten uns für eine Unterorganisation der Liverpooler Stadträte der Militants», die zu diesem Zeitpunkt bereits von Thatchers Regierung entlassen und von der Labour Party wegen Linksabweichung ausgeschlossen worden waren. Und so sei es beim üblichen Vorgehen des Staates geblieben: Noch mehr Polizei, die im Kampf gegen die streikenden Bergarbeiter 1984-85 martialisch hochgerüstet worden war. Noch rigorosere Kontrolle der tatsächlich randalierenden oder nur feiernden Fans. Noch härtere Strafen, noch mehr Zäune und «policing by containment». Vier Jahre nach ihrer Gründung hatte die FSA rund 10.000 Mitglieder. Und das Dossier? «Wenn man es heute liest, friert es dich.» Denn darin seien schon die Lösungen gestanden, die all das verhindert hätten, was wenige Jahre später zur größten Katastrophe in der britischen Fußballgeschichte führen sollte.
Käfighaltung der Arbeiterklasse
15. April 1989: Pokalhalbfinale zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest, ausgetragen im Hillsborough-Stadion von Sheffield Wednesday. Von der Mersey waren Zehntausende angereist, denen die von Liverpool aus schlechter erreichbare Kurve an der Leppings Lane zugewiesen worden war (ein Fehler, wie sich schnell herausstellen sollte). Die Wege waren schlecht ausgeschildert (ein zweiter Fehler), vor den wenigen Drehkreuzen drängelten sich die Menschen, die sich selber überlassen blieben (Fehler Nummer drei), denn der Anpfiff rückte näher, die Zeit drängte. Und so entschied die überforderte Polizei unter dem Kommando von David Duckenfield, der noch nie einen solchen Einsatz geleitet hatte, das Tor «Gate C» direkt vor dem Leppings Lane Stand zu öffnen (vierter Fehler). Dicht an dicht strömten die Fans durch einen miserabel beleuchteten Tunnel (noch ein Fehler), verpassten die Abzweigungen zu den weniger bevölkerten Sektoren links und rechts und drückten sich in die Menge, die bereits im überfüllten Mittelblock stand. Ein Ausweichen auf die beiden anderen Blöcke war nicht möglich, da die Zäune zwischen den Sektoren (anders als in Heysel) jedem Druck stand hielten – und auch kaum zu überklettern waren. Für diesen Kardinalfehler hatten die von einer sicherheitsbesessenen Polizei, von rücksichtslosen Politikern und ahnungslosen Funktionären ergriffenen Maßnahmen nach Heysel gesorgt.
Die in die Mitte gelenkte Masse schwoll an, die ersten wurden gegen den befestigten Zaun zum Spielfeld gedrängt und fielen in Ohnmacht, ihre Gesichter liefen violett an – und noch immer reagierte niemand, obwohl Duckenfield und seine Stellvertreter in ihrer Kabine einen guten Überblick hatten. Es gab kaum Sanitäter vor Ort, die die Symptome hätten deuten können. Und die Polizisten schauten weg. Aber nicht nur das: Als es verzweifelten Fans gelang, ein Tor zum Spielfeld zu öffnen, das den Druck hätte mindern und eine Flucht ermöglichen können, stemmte sich die Polizei auf Anweisung von oben dagegen und schloss es wieder. Man habe eine Invasion der Fans aufs Spielfeld befürchtet, rechtfertigten sich später die Verantwortlichen.
Erst später, nachdem das Spiel, das pünktlich um 15.00 Uhr begonnen hatte, um 15.06 Uhr abgepfiffen wurde, nachdem Liverpooler Fans Verletzte und Tote auf Werbetafeln, die sie aus der Verankerung gerissen hatten, aufs Spielfeld geschleppt und über die Absperrungen gehievt hatten, wurde das Ausmaß der Katastrophe sichtbar. 94 Menschen, darunter 38 jünger als zwanzig, waren an diesem Nachmittag sofort umgekommen – zu Tode gequetscht, niedergetrampelt, erstickt. Zwei weitere erlagen später ihren Verletzungen.
Das Desaster hat die Fans, den Club und die ganze Stadt dauerhaft verändert. Nach Schock und fassungslosem Entsetzen kam Empörung und auf diese folgte ein kollektiver Zorn, der bis heute anhält – auf die Verantwortlichen: Die Polizei von South Yorkshire, die den Fans die Schuld zuschob; Thatchers Regierung, deren Sprecher Bernard Ingrim ebenfalls die Scouser beschuldigte; auf die Boulevard-Medien, die Verbandsfunktionäre, die Ermittlungsbehörden. Aus dem Club, der sich bis dahin (etwas vermessen) als Familienverein verstanden hatte, wurde binnen weniger Stunden das Kernstück einer ganz großen Familie, die die ganze Stadt umfasste, inklusive der vielen Anhänger von Everton. Am folgenden Sonntag strömten Zigtausende an die Anfield Road, wo die Terrassen (nicht nur der Kop) und das Spielfeld unter einem Meer an Blumen, Schals, Fahnen, Kränzen, Karten versunken waren; in den folgenden Tagen schwoll die Zahl der Trauernden, die zum Stadion pilgerten, auf rund 200.000 an. Es folgten Gedenkgottesdienste, eine Menschenkette vom Stadtzentrum über die Anfield Road zum Goodison Park, Geldsammlungen für die Hinterbliebenen und die über 700 Verletzten.
Justice for Hillsborough
Besonders bestürzt regierten die Scouser auf Geschichten, die schnell die Runde machten. Sie waren von der South Yorkshire Police in Umlauf gebracht worden. Die Liverpooler Fans seien betrunken und gewalttätig gewesen, hätten das Gate C durchbrochen, die zur Hilfe eilenden Sanitäter attackiert, Polizisten angepinkelt und die Toten ausgeraubt. Von einer Nachrichtenagentur verbreitet, griffen zahllose Medien diese Behauptungen auf, darunter seriöse Blätter, die BBC und insbesondere die Boulevard-Zeitungen. Besonders dreist trieb es dabei die auflagenstarke «Sun» des reaktionären Medienmagnaten Rupert Murdoch, die vier Tage nach Hillsborough unter dem Titel «Die Wahrheit» auf der ersten Seite schrieb: «Einige Fans bestahlen die Opfer, einige Fans urinierten auf die tapferen Polizisten, einige Fans schlugen einen Beamten zusammen, der per Mund-zu-Mund-Beatmung retten wollte.» Seither wird die «Sun» in Liverpool boykottiert; trotz einer durchsichtigen Entschuldigung des Verlags 15 Jahre später (die Auflage war in den Keller gestürzt) ist das Blatt in Merseyside immer noch verpönt. «Kaufe nicht die Sun!» steht weiterhin in den Statuten Liverpooler Fan-Clubs.
Es waren also wieder sie gewesen, die die Katastrophe ausgelöst hatten – die «gewalttätigen», «militanten», «vom Sozialstaat verwöhnten» und «arbeitsscheuen» Fans dieser «aufsässigen» Stadt an der Mersey. Diesem Stereotyp widersetzten sich zwar die Familien der Toten und Verwundeten, die sich zur Hillsborough Family Support Group zusammengeschlossen hatten, ebenso wie deren Anwälte und alle Fussballfans. Dennoch beherrschte weiterhin dieser Tenor die Kommentarspalten, selbst Psychologen glaubten sich mit dem auffälligen Charakter der Merseysider beschäftigen zu müssen, die sich vor allem «selber bemitleiden». Und das, obwohl der mit einer Untersuchung der Ereignisse beauftragte Lord Justice Taylor bereits Anfang August 1989 in einem Zwischenbericht der Polizei die Hauptschuld an der Tragödie gab. Sie habe die Kontrolle verloren, urteilte Taylor, der auch den Stadioneigentümer Sheffield Wednesday kritisierte. Die Fans hingegen seien nicht verantwortlich gewesen. Kurz darauf befeuerte jedoch der Leichenbeschauer Stefan Popper in seiner Untersuchung wieder alle Vorbehalte. Er hatte Alkoholtests von allen Toten (auch den Minderjährigen) vornehmen lassen, tolerierte entwürdigende Kreuzverhöre von Augenzeugen durch Polizeianwälte – und sprach die Behörden frei. Sein Verdikt nach anderthalbjährigen Verfahren: «accidental death», Tod durch Unfall. «Damit war der Optimismus, der nach Taylors Bericht herrschte, verflogen», schreibt Phil Scraton in seinem detaillierten Buch «Hillsborough – The Truth». Es war zum Verzweifeln.
Die Angehörigen und Fans ließen dennoch nicht locker. Ihre Anwälte beantragten eine Überprüfung der Polizeimaßnahmen durch die Polizei-Ombudsbehörde. Diese attestierte den verantwortlichen Beamten eine «Vernachlässigung ihrer Pflichten», stellte aber das Verfahren im Juli 1991 ein. Sie erhoben Einspruch gegen das Verdikt des Leichenbeschauers. Dieser wurde im Herbst 1993 zurückgewiesen. Sie setzten auf die Wirkung des zweistündigen Dokumentarfilms «Hillsborough» des Liverpooler Autors Jimmy McGovern, der im Herbst 1996 vom Regionalfernsehen Granada-TV zur besten Sendezeit ausstrahlt wurde. Umsonst. Sie hofften auf eine Kampagne des linksliberalen Boulevardblatts «Daily Mirror», das eine neuerliche Untersuchung forderte. Vergebens. Sie reisten zum Jahresende 1996 nach Westminster, weil die Liverpooler Abgeordneten dort eine Debatte im Unterhaus verlangt hatten. Die Diskussion dauerte gerade mal 26 Minuten. Im darauffolgenden Juni, kurz nach Labours Wahlsieg, sassen sie wieder auf der Zuschauertribüne des House of Commons und forderten «Justice», Gerechtigkeit. Die Debatte währte dieses Mal vier Stunden, doch das Ergebnis war nicht viel besser. Zwar installierte Labours Innenminister Jack Straw ein Gremium, das prüfen sollte, ob «neue Erkenntnisse» vorliegen. Da dieses jedoch zu einem negativen Bescheid kam, beerdigte Straw alle Erwartungen: Da sei leider nichts zu machen.
Die Fans, die Angehörigen, die Lokalpolitiker, der Club und selbst die Anhänger anderer Fussballvereine ließen es dabei nicht bewenden. 1998 entstand die breit unterstützte Hillsborough Justice Campaign mit einem Büro an der Walton Breck Road, direkt gegenüber dem Anfield Stadion. Sie und andere engagierte Gruppen lancierten Solidaritätsaktionen, organisierten immer wieder Schweigeminuten (meist um 15.06 Uhr), veranstalteten Mahnwachen, platzierten riesige Banner in der Liverpooler Innenstadt, setzten weiter auf Druck von unten – und erreichten, dass zum 20. Jahrestag 2009 die Regierung eine unabhängige Untersuchungskommission einsetzte, die erstens sofort alle Dokumente veröffentlichte und zweitens im 2012 zu dem Ergebnis kam, dass «kein einziger der Liverpooler Fans» für Hillborough verantwortlich zu machen sei, dass fast die Hälfte der Opfer durch rechtzeitige und adäquate Hilfe hätten gerettet werden können, dass zahlreiche Zeugenaussagen von der South Yorkshire Police nachträglich verfälscht worden und dass Berichte über angeblichen Alkoholmissbrauch völlig übertrieben gewesen seien. Kurz darauf setzte ein High Court auf Antrag der britischen Generalstaatsanwaltschaft ein neues Überprüfungsverfahren an, das im März 2014 begann und im April 2016 – 27 Jahre nach Hillsborough – zu einem ganz anderen Urteil gelangte als Popper 1991: Der Tod der 96 Fans von Hillsborough sei nicht zufällig gewesen, keinem «Unfall» geschuldet, sondern durch «gesetzwidriges» Handeln verursacht. Ganz enden wird der Kampf um Gerechtigkeit wohl erst mit dem Verfahren gegen den damaligen Police Chief Indendent David Duckenfield; er steht derzeit wegen Totschlags vor Gericht.
Solidarität und Widerspruch
Die lange Hillsborough-Justice-Kampagne war nicht das einzige Thema, das die Liverpooler Bevölkerung umtrieb, nicht das einzige Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnte, nicht der alleinige Anlass, der den LFC, seine Fans und die Bevölkerung zusammenbrachte. Als beispielsweise im September 1995 die durch die Containerisierung geschrumpfte Belegschaft der Liverpooler Docks entlassen wurde, weil sich die Docker den zunehmend prekären Arbeitsbedingungen und der Einführung des Tagelohns im Hafen widersetzten, schlugen sich viele auf die Seite der Schauerleute. Tausende kamen zu ihren Demonstrationen; die Hafenarbeiter und ihre Frauen (die «Women of the Waterfront») organisierten zahllose Veranstaltungen im ganzen Land; die Stadtverwaltung stellte das Rathaus für ein internationales Dockertreffen zur Verfügung; die Bischöfe der Stadt protestierten gegen das Vorgehen der Hafenfirma; Ken Loach drehte einen Dokumentarfilm über den epochalen Konflikt; lokale Lkw-Fahrer verweigerten den Transport von Hafenfracht; Schulklassen brachten ihr Erspartes – und vor den Stadien des FC Liverpool und des FC Everton füllten Fans die Sammelbüchsen zugunsten der Docker (die kein Streikgeld bekamen).
Beeindruckend auch die grenzüberschreitende Solidarität: Von den USA bis Australien, von Japan bis Portugal boykottierten Hafenarbeiter Schiffe, die in Liverpool beladen worden waren; am internationalen Aktionstag zugunsten der Liverpooler Anfang 1997 beteiligten sich Docker in 27 Ländern. Über zwei Jahre lang kämpften die 500 Schauerleute für ihre Wiedereinstellung, dann gaben sie – im Stich gelassen von der Gewerkschaftsspitze und ignoriert von der Labourführung – Anfang 1998 ihren Widerstand auf. Von diesem langen kollektiven Ringen um Fairness und Gerechtigkeit blieb jedoch eine Aktion am besten im Gedächtnis haften: Die des LFC-Spielers Robbie Fowler im März 1997. Fowler trug wie Steve McManaman (beide sind an der Mersey aufgewachsen) beim Viertelfinale des UEFA-Europacups der Pokalsieger ein Docker-Solidaritätsshirt unter dem Trikot – und zeigte es beim Torjubel. Die Fans waren begeistert von ihrem «Working Class Hero», die UEFA nicht: Sie verdonnerte Fowler wegen «politischer Demonstration» zu 900 Pfund Geldstrafe. Das Bild, auf dem Fowler seine Unterstützung der Hafenarbeiter zeigt, kursiert durchs Netz – und hängt an prominenter Stelle im «Casa», dem linken Pub und Bewegungszentrum an der Hope Street. Es gehört den Dockern, die hier einen Teil der Abfindung investierten, die sie am Ende noch hatten durchsetzen können. Mit etwas Glück trifft man im Casa weiterhin Terry Teague und Tony Nelson, die den Widerstand massgeblich organisiert hatten und inzwischen im Auftrag der Gewerkschaft jene Hafenarbeiter vertreten, die an ihre Stelle gerückt waren – und in Arbeitskämpfe führen.
Protest in der 77. Minute
Natürlich waren (und sind) nicht alle Liverpooler Fans so freundlich, wie viele sich selber gern sehen. 2005 kam es beispielsweise nach dem Gewinn der Champions League in einem bulgarischen Seebad zu einem bösen Streit zwischen angetrunkenen Scousern und einem bulgarischen Barkeeper, der bei der Schlägerei starb. Doch Michael Shields, der danach verhaftet und zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt worden war, hatte die Tat nicht begangen; es war – wie sich schnell herausstellte – ein anderer gewesen. Da die bulgarische Justiz eine grundlegende Revision des Urteils ablehnte, setzte bald eine Kampagne ein, an der sich zahlreiche Fans, die beiden lokalen Zeitungen (dem «Echo» und der «Daily Post») und unter anderen auch der damalige Bürgermeister Joe Anderson (ein Everton-Fan) beteiligten. Bei Liga-Spielen hoben Fans auf dem Kop bunte Tafeln in die Höhe, die den Schriftzug «Free Michael Now» ergaben; LFC-Spieler trugen beim Aufwärmen Shirts mit derselben Botschaft; und als Shields 2006 nach England verlegt worden war, um seine Reststrafe im Heimatland zu verbüßen, organisierte der Fanclub Spirit of Shankly (SoS) Kundgebungen vor dem Justizministerium in London. 2009 gab der Innenminister dem Druck nach und begnadigte ihn.
Kurz zuvor – Anfang 2008 – war SoS in einem Pub gegründet worden. Die inoffizielle Fangemeinschaft fordert – wie über zwanzig Jahre zuvor die FSA, die mittlerweile in der nationalen Football Supporters Federation aufgegangen ist – seither Mitsprache, organisiert Reisen zu Auswärtsspielen und verlangt von der Clubführung Rechenschaft. Anlass war der erste große Besitzerwechsel in der LFC-Geschichte gewesen: 2007 hatten die bisherigen Eigentümer den Club an zwei US-Geschäftsleute verkauft, die großzügige Investitionen und ein neues Stadion versprachen, tatsächlich aber nur auf schnelle Rendite schielten. Und so sang der Kop bald Schmählieder an die Adresse von George Gillett und Tom Hicks und zeigte Banner mit der Aufschrift «Built by Shanks. Broke by Yanks» (Gebaut von Shankly. Zerstört von Yankees). Parallel dazu initiierte FSA-Mitbegründer Rogan Taylor das Projekt Share Liverpool: Wenn 100.000 Fans jeweils 5000 Pfund aufbrächten, so die Idee, könnten sie den Club übernehmen. Eine reizvolle Vorstellung, die sich jedoch – auch wegen der grassierenden Armut in der Stadt – nicht realisieren ließ. Dabei hatte sich SoS-Mitglieder einiges einfallen lassen. Im Februar 2010 tauchten in der ganzen Stadt Plakate auf: «Tom and George – not welcome here!», im Juni doppelten sie mit einer internationalen Aktion nach (Fans im Ausland sandten Fotos mit dem Slogan «Tom and George – not welcome anywhere!») und am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, folgte eine Großkundgebung auf dem St. George's Hall Plateau, dem größten Platz mitten in der Stadt: «Unabhängigkeit von den US-Besitzern!»
Zwar gaben vor allem Kreditprobleme im Zuge der Finanzmarktkrise ab 2008 den Ausschlag, aber einen Anteil am Besitzerwechsel 2010 hätten die Fans durchaus gehabt – das versicherten jedenfalls die neuen Eigentümer von der US-amerikanischen Fenway Sports Group nach der Übernahme. Doch auch sie blieben von Protesten nicht verschont: Im Februar 2016 kam es zum ersten großen Walk-out in den Clubgeschichte. Kurz zuvor hatte die Clubführung den Preis für das teuerste Matchticket von 59 auf 77 Pfund erhöht. Man habe die Gebühr für einen Platz auf der Haupttribüne nur moderat erhöht (1989 kostete das Ticket noch 4 Pfund), argumentierte das Management, und die Preise für andere Tickets sogar gesenkt. Vergebens. «You greedy bastards, enough is enough», skandierte der Kop, Und dann, in der 77. Minute, beim Spielstand von 2:0 gegen Sunderland, verließen zehntausend Zuschauer die Ränge. Das Spiel endete 2:2. Selten zuvor konnten Fans so eindrücklich demonstrieren, wie wichtig sie sind. Vier Tage später entschuldigten sich die Clubführung, nahm die Erhöhung zurück und fror die Ticketpreise für die folgenden zwei Spielzeiten ein.
Nie rechts wählen
Auf die Gemeinschaft kommt es an – hatte das nicht schon Bill Shankly postuliert? Die Liverpooler Trainerlegende ist nicht nur für das Diktum bekannt geworden, demzufolge es beim Fussball um mehr gehe als um Leben und Tod («Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it's much more serious than that»). Sondern auch für seine Definition von Sozialismus: «Im Sozialismus, an den ich glaube, arbeiten alle füreinander und alle haben einen Anteil an den Früchten. So sehe ich den Fussball und so sehe ich das Leben.» Dieser Spruch prangt noch immer ganz oben auf der Homepage der Fangemeinschaft «Spirit of Shankly.
Shankly war nicht der einzige in der Clubgeschichte, der so dachte. Steve Heighway zum Beispiel – er spielte in den glorreichen siebziger Jahren linksaußen und leitete von 1989 bis 2007 die Jugendakademie des LFC, aus der Spieler wie Steve McManaman, Robbie Fowler, Michael Owen, Jamie Carragher und Steven Gerrard hervorgingen – erläuterte die dem Club eigene Philosophie einmal so: Gute Kicker habe der Club immer schon gehabt, aber wirklich groß geworden seien fast alle erst wirklich in Liverpool, denn «Wir pflegen hier seit Jahrzehnten einen sehr sozialistischen, gemeinschaftlichen Stil. Jeder macht seinen Job, so gut er kann, und hilft den anderen.» Und weiter: «Die Grundsätze unserer Spielweise sind sehr einfach: Bewegung ohne Ball, schnelle Abgabe des Balls, ständiges Passspiel – das ist die Basis unseres Spiels. Andererseits wird die Individualität nicht unterdrückt.» Obwohl es auf dem Platz ständig heiße Gib den Ball! Gib ihn her!, «führt plötzlich jemand den Ball übers ganze Feld und vollbringt etwas Wunderbares. Darin liegt die Schönheit unseres Spiels. Wir hatten immer hervorragende Individualisten, die aber alle bereit waren, ein Stück ihrer Individualität zugunsten des Kollektivs aufzugeben.»
Vielleicht halten ja die Scouser auch deswegen so große Stücke auf Jürgen Klopp, dessen Empathie – nicht nur auf dem Spielfeld – ihnen aus der Seele spricht. Schließlich hatte er einmal gesagt: «Ich bin links, natürlich. Eher links als Mitte. Ich glaube an den Sozialstaat. Ich bin nicht privat versichert. Ich würde niemals für eine Partei stimmen, weil sie verspricht, den Spitzensteuersatz zu senken.» Und dann führte Klopp aus: «Wenn es mir gut geht, will ich, dass es anderen auch gut geht. Wenn es etwas gibt, was ich nie im Leben tun werde, ist es, rechts zu wählen!»
Erinnerung an die Bergarbeiter
Und so sind auch die Fans politisch aktiv geblieben. Seit Frühjahr 2018 taucht auf dem Kop immer wieder ein großes Transparent auf, das gleich mehrere Sujets bündelt. Es bezieht sich auf die «Blacklist Group» (Liverpooler Bauarbeiter, die wegen ihrer Gewerkschaftstätigkeit auf schwarze Listen gesetzt wurden), es erinnert an die «Shrewsbury Two» (zwei Streikposten, die in den 70er Jahren aufgrund eines Fehlurteils langjährige Haftstrafen verbüßten) und es zeigt das Symbol der «Orgreave-Kampagne für Wahrheit und Gerechtigkeit». Bei der ehemaligen Kokerei Orgreave hatte die South Yorkshire Police im Juni 1984, fünf Jahre vor Hillsborough, streikende Bergarbeiter attackiert und danach alles vertuscht und verdreht. Auf dem Banner sind auch das Logo der Hillsborough-Kampagne zu sehen – sowie die Konterfeis des linken Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn und dessen nicht minder linken Schatten-Schatzkanzlers John McDonnell (einem Liverpool-Fan).
Corbyn, der stets für die Marginalisierten eintrat, jeden Streik unterstützte und aufgrund seiner Prinzipien jahrzehntelang als Labour-Abgeordneter auf Hinterbänken sass, bevor er 2015 von einer breiten Bewegung an die Parteispitze gewählt wurde – dieser Corbyn, schrieb Jeff Goulding in seinen Blogbeitrag «Hope in our Hearts», kenne die Kraft der Solidarität. Er weiß «wie wir, dass der Weg zum Erfolg oft lang sein kann», dass «Einigkeit stark macht» und dass es «immer besser ist zu kämpfen und eine Niederlage zu riskieren als zu kapitulieren».
Gouldings Worte mögen Außenstehenden vielleicht etwas pathetisch vorkommen. Einem großen Teil der Liverpooler Bevölkerung, die zuletzt 75 Labourabgeordnete ins 90-köpfige Lokalparlament wählte (und keinen einzigen Konservativen), dürften sie jedoch aus dem Herzen geschrieben sein. Als das «Liverpool Echo» seine Leserschaft fragte, was sie von dem Polit-Banner halte, war die Antwort eindeutig. Fast drei Viertel der Angesprochenen, so das Ergebnis, sind «stolz» darauf. (pw)
P.S. Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch «Reds. Die Geschichte des FC Liverpool»; nähere Infos hier klicken..


